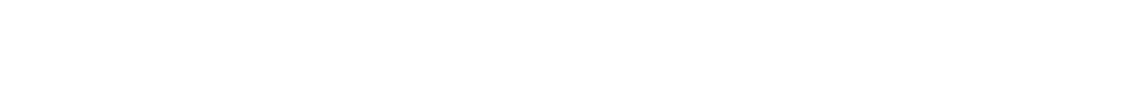Schlüsselpunkte des Qi Gong: 5. Natürlichkeit
(ebenso gültig für Tai Ji Quan und Yi Quan)
Die meisten Qi Gong-Methoden beruhen auf „Natürlichkeit“ als einem Grundprinzip. Natürlichkeit bedeutet dabei zunächst mal grundsätzlich so viel wie „ohne Zwang“ – und betrifft alle Aspekte des Übens (Körperhaltung, Bewegung, Atmung, Vorstellungskraft, …, Übungsdauer usw.).
Ein oft gebrauchter chinesischer Begriff ist in diesem Zusammenhang: 自然 Zi Ran – „natürlich“; Natur-
- 自 Zì – selbst; sicherlich; natürlich
- 然 Rán – richtig; korrekt; so; so wie
„Ohne Zwang“ / „ohne Gewalt“ / „natürlich“ bedeutet im weiteren Sinne auch, dass man im Qi Gong oft (nur) gute Voraussetzungen schaffen kann – aber bestimmte Dinge eben nicht „erzwingen“ kann. Beispielsweise wächst Gras nicht schneller, wenn man an den Grashalmen zieht. Allerdings kann man günstige Bedingungen für das Wachstum des Grases schaffen (Boden, Wasser, Licht, …) so dass das Gras am Ende ganz von selbst – „natürlich“ – wachsen kann.
(Ich vergleiche das, z.B. für’s Üben betrachtet, auch gerne damit, dass wenn man versucht zu schnell zu rennen – sozusagen schneller als man eigentlich „kann" –, schnell ins Stolpern kommt – und dann letztendlich langsamer voran kommt wie wenn man nicht so schnell gerannt wäre → man kann nichts erzwingen...)
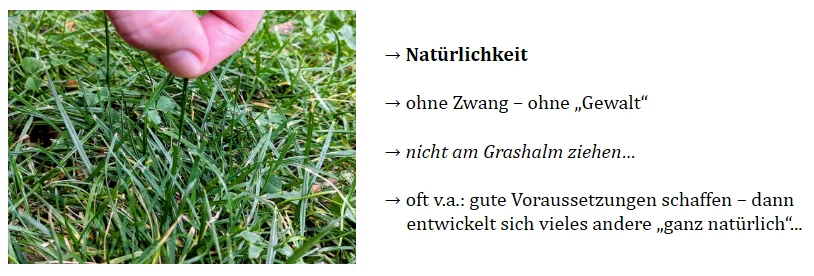
Die Frage ist nun allerdings: Was ist „natürlich“? Denn das ist gar nicht so einfach abzugrenzen von z.B. Gewohnheit und Anstrengung...
Natürlichkeit, Gewohnheit und Anstrengung (und "Gong Fu", "bitter essen"...)
Alles Ungewohnte ist auch erst mal anstrengend. Und es braucht eine Zeit des Übens, bis das Ungewohnte gewohnter wird – sich natürlicher anfühlt. Deswegen darf man „Anstrengung“ und „fühlt sich ungewohnt an“ nicht mit „ist irgendwie unnatürlich“ verwechseln. Oder andersherum: Nicht alles, was anstrengend und ungewohnt ist, ist automatisch „unnatürlich“. „Natürlichkeit“ bedeutet also nicht, dass es keine Anstrengung gibt beim Qi Gong-Üben. Im Gegenteil, ernsthaftes Üben kann "harte Arbeit" (功夫 Gong Fu) sein.
- 功 Gōng – Leistung, Errungenschaft, Verdienst, gutes Ergebnis; Arbeit
- 夫 Fū – Ehemann; Mann (… und hier hilft die wörtliche Übersetzung mal definitiv nicht weiter… 夫 Fū bedeutet hier so viel wie „Zeit“ - im alten China nämlich „die Zeit oder auch Entwicklung, zum Mann zu werden“)
Gong Fu bedeutet also: mittels großer Anstrengung / Fleiß über lange Zeit etwas zu Entwickeln/Erlangen – z.B. bestimmte Fähigkeiten. (da „Gong Fu“ auch in sämtlichen anderen Zusammenhängen benutzt wird, muss es sich nicht zwingend um Kampfkunstfähigkeiten handeln – der Begriff Gong Fu – oder Kung Fu – hat sich zwar eingebürgert als Begriff für die chinesischen Kampfkünste, aber eigentlich meint er das gerade Beschriebene)
Im Chinesischen gibt es dafür auch den Ausdruck 吃苦 Chi Ku – „bitter essen“ –, der allerdings meistens eher im Zusammenhang mit den Kampfkünsten genannt wird und weniger beim Qi Gong (aber auch hier zutreffen kann).
- 吃 Chī – essen; erschöpfen, verbrauchen; erleiden
- 苦 Kǔ – bitter; Leiden, Schmerz, Erschwernis/Bitternis/Härte
"Bitter essen" bedeutet, dass das Training nicht immer nur einfach, schön oder angenehm ist, sondern auch "harte Arbeit" sein kann.
无为 Wu Wei – „Handeln durch Nicht-Handeln“
Ein weiterer Begriff, der auch in Zusammenhang mit Natürlichkeit steht, ist 无为 Wu Wei.
- 无(無) Wú – nichts, nicht, Nichts, Null
- 为(為) Wéi – machen, tun; werden; sein; erscheinen
Dieser Begriff kommt hauptsächlich aus dem Kontext des Daoismus und wird häufig als „Handeln durch Nicht-Handeln“ übersetzt – denn „Handeln“ (i.S.v. „zu viel machen“/“zwingen“) ist falsch, aber „Nicht-Handeln“ (i.S.v. „zu wenig machen“) ist auch falsch. Gemeint ist mit „Handeln durch Nicht-Handeln“ also eigentlich ein „natürliches“ Handeln – weder zu viel noch zu wenig, sondern „genau richtig“ bzw. passend – und damit (immer) der Situation entsprechend. (Das ist jedoch vermutlich ein Idealzustand, den man nicht immer erreichen kann.) – Auch hier ist also die Idee eines „Tuns ohne zu zwingen“ enthalten.
(Kurze Anmerkung zum vorherigen Abschnitt: in unserer Sprache und unserem Denken haben wir oft ein „entweder … oder“ = es ist entweder das eine oder das andere… → im chinesischen Denken – auch passend zu Yin und Yang – hat man hingegen oft ein "sowohl … als auch", also ein Ausgleich von Gegensätzen bzw. Widersprüche werden integriert so dass „beides gleichzeitig gilt“ → und das passt ganz gut auch zur obigen Erklärung von 无为 Wu Wei, wofür es auch einen Spruch gibt wie "weder Tun noch nicht-Tun – dies ist wahres Tun".)
Weitere Aspekte
Hier ein paar weitere Aspekte, die ebenfalls mit „Natürlichkeit“ in Zusammenhang stehen (manches davon wurde vorher schon kurz erwähnt, soll hier aber der Vollständigkeit halber erneut mit angefügt werden):
- Übungen nicht nur kopieren / nachmachen → „natürlich“ wäre es, sie einem selbst entsprechend auszuführen → und das bedeutet, dass es oft Variationen/Varianten geben darf
- im weiteren Sinne fällt unter Natürlichkeit auch, dass die „Form“ nicht zu genau sein muss – und schon gar nicht „fixiert“ sein darf → u.a. entwickelt sich alles mit der Zeit weiter / verändert sich
- eigene Konstitution, Fähigkeiten und Vorlieben berücksichtigen (statt „blind“ und mit Gewalt Übungsanweisungen zu befolgen) → die Yang-Familie (aus dem Tai Ji Quan) sagt dazu: „find your angle“ (finde deinen Winkel)
- grundsätzlich „der eigenen Empfindung“ folgen (diese kann aber auch in die Irre führen, insofern sollte man im Austausch mit dem Lehrer bleiben)
- dem "Fluss" dessen folgen, was sich ergibt - auf das eigene "Gefühl" hören (Ruhe, Entspannung, Achtsamkeit usw. sind wichtig, um zu lernen, die eigenen Signale wahrzunehmen)
- Tagesform beachten → z.B. heute lockerer zu üben weil es „passt“ – und „nicht zwingen“ zu üben, wenn einem mal wirklich gar nicht danach ist
- nichts festhalten, weder geistig noch körperlich → alles ist in Veränderung, in einem „Fluss“ begriffen → „natürlich“ wäre es, mit diesen Veränderungen „mitzugehen“
- Rhythmen berücksichtigen – z.B. auch Wechsel von Anspannung und Entspannung (und idealerweise ein "natürlicher" Rhythmus, kein von außen aufgezwungener Rhythmus z.B. durch Musik oder weil andere sich genauso schnell bewegen)
- nicht am Grashalm ziehen! → weder versuchen etwas herbeiführen was (gerade) nicht "passt", noch etwas versuchen zu verhindern, was sich zeigen möchte
- „natürlich“ heißt auch körperlich: anatomisch-physiologische sinnvolle Ausrichtung/Körperhaltung und Bewegung (wir wollen z.B. Gelenke nicht ungünstig belasten)
- unser Körper ist auf Bewegung ausgelegt – wir bewegen uns eigentlich ständig, und seien es nur Ausgleichsbewegungen für das Gleichgewicht u.a.m. – diese „natürliche“ Bewegung sollte man nicht versuchen zu unterdrücken (und selbst in Übungen, die „bewegungslos“ sein sollen, wollen wir eigentlich nie wie „erstarrt“ sein im Körper)
- „wenn sich ein Teil bewegt, bewegen sich alle Teile“ → wenn nirgendwo "festgehalten" wird, dann hat jede Bewegung an einer Stelle des Körpers einen Einfluss auf den gesamten Körper (und umgekehrt)
- die Atmung grundsätzlich "natürlich", damit sie sich natürlicherweise anpassen kann an das, was man gerade macht
- Natürlichkeit heißt auch: alles ist im Wandel, im Fluss - deswegen: nie Übungen "wiederholen" i.S.v. „genau gleich wiederholen“, denn wir wollen ja immer dazulernen und die nächste Übung besser machen als die vorherige! → dazu passt aus dem Zen-Buddhismus die Idee eines „Anfänger-Geistes“: jede einzelne Übung immer so ausführen, als ob man sie noch nie gemacht hätte (d.h. als ob man Anfänger wäre) - etwas genau gleich zu machen wie vorher ist "nicht natürlich" (zumindest bei lebenden, dynamischen Systemen)... (Anmerkung: diesen Punkt natürlich nicht zu wörtlich verstehen – natürlich müssen Übungen auch wiederholt werden!)
- Natürlichkeit bedeutet auch, dass Veränderungs- und Übungsprozesse Zeit brauchen → Resultate können nicht erzwungen werden - und auch nicht "vorangetrieben" werden - am ehesten werden sie noch vorangetrieben, wenn man achtsam weiterübt, die Ziele am besten sogar (ein Stück weit) loslässt, sich auf die Übungsanweisungen und -Prinzipien konzentriert usw.
- Natürlichkeit bedeutet für unser Üben auch immer Ausgleich von Gegenpolen, also die Dynamik von "Yin/Yang" zu integrieren → Steigen und Sinken, Innen und Außen, Öffnen und Schließen, (Rhythmus) usw.
- „Balance“ und Ausgleich → überall Aktivität im Körper → keine inaktiven Regionen im Körper
- dynamisch vs. „statisch“ → dynamisch ist meist natürlicher als statisch
- auch den Körper nicht zu sehr zu etwas zwingen, nicht in eine gewisse Form pressen - der Körper, also z.B. Körperhaltung und Bewegungen, folgen der Vorstellung – d.h. insgesamt nicht zu sehr an der "Form" festhalten oder herumdoktern, denn die (äußere) "Form" ist Ausdruck und Ergebnis der Vorstellungsarbeit "Yi"
- „natürlich“ heißt allerdings nicht, dass alles „beliebig“ ist → z.B. Übungsanweisungen haben ihren Sinn sollten grundsätzlich und zunächst mal befolgt werden
- am Anfang muss man lange üben, um mit den Übungen vertraut zu werden und besser reinzukommen – nicht jede Unannehmlichkeit oder Anstrengung ist jedoch direkt als „fühlt sich nicht natürlich an“ absolut zu vermeiden – oft muss man erst mal sehr viel in Übungen/Übungszeit investieren, bis sich manche Übungen besser und „natürlicher“ anfühlen → diesen Prozess darf man nicht zu früh abbrechen, sonst verhindert man diese Entwicklung
- auf der anderen Seite ist es auch hier wieder gut, nicht mit „Zwang“ vorzugehen – manchmal ist es auch gut, bestimmte Sachen erst mal ruhen zu lassen, sich ggf. anderen Übungen zu widmen – und zu einem späteren Zeitpunkt zu den „unangenehmen“ Übungen zurückzukehren → oft fühlen sich diese dann besser an ohne sie geübt zu haben, da man an anderen Übungen bestimmte Teilaspekte gelernt hat die auch hier eine Rolle spielen – das gehört manchmal auch zu „Natürlichkeit
- möglichst „mühelos“ und mit Minimalkraft bewegen
- Natürlichkeit hat nicht nur damit zu tun, bestimmte Dinge zu machen, sondern oft mehr noch damit, bestimmte andere Dinge aufzuhören / zu lassen (z.B. nicht mehr zu tun als nötig, nicht anzuspannen wenn keine Anspannung notwendig ist usw.)
- als letzten Punkt hier noch mal deutlich: die Idee von „Natürlichkeit“ bedeutet nicht, immer nur den einfachsten Weg zu gehen und jede Anstrengung als „unnatürlich“ anzusehen, sonst gibt es keine Weiterentwicklung – man muss sich auch schon Sachen erarbeiten, die sich am Anfang nicht vertraut/gewohnt anfühlen, vielleicht anstrengend sind, und sich erst mit der Zeit immer „natürlicher“ anfühlen
Zum Schluss muss man auch noch eine weitere Einschränkung machen: „Natürlichkeit“ als ein Schlüsselpunkt des Qi Gong ist mehr der „daoistischere“ Ansatz – es gibt auch „härtere“ Qi Gong-Methoden, die etwas mehr „Zwang“ einsetzen, so dass der Schlüsselpunkt der „Natürlichkeit“ dort nur eingeschränkt gilt.
Weiterlesen: